Am kommenden Sonntag findet hierzulande die Europawahl 2019 statt. Da wir uns hier auch mit Sprache beschäftigen, greifen wir doch einmal die Sprachen in der EU und in deren Organen auf. Auch unter besonderer Berücksichtigung des Deutschen!

Die Amtssprachen in der EU

Zu den halbamtlichen Sprachen zählen Baskisch, Galicisch, Katalanisch, Schottisch-Gälisch und Walisisch. Diese sind jedoch weder Arbeits- noch Vertragssprachen der EU, aber für die Korrespondenz mit den Institutionen der EU verwendbar. Ohne offiziellen Status sind hingegen Luxemburgisch und Türkisch.
Arbeits- und Vertragssprachen in der EU
Von den vorher genannten Amtssprachen finden vor allem drei im internen Verkehr der Organe der EU Verwendung: Englisch, Französisch und Deutsch. Sie sind die Arbeitssprachen und dienen der internen Kommunikation unter den EU-Mitarbeitern. Verträge werden aber in allen in Art. 55 EU-Vertrag genannten Amtssprachen verfasst!
Redebeiträge im Europäischen Parlament sind in jeder der genannten Amtssprachen möglich, wobei Dolmetscher zur simultanen Übersetzung dienen. Die Frage der Sprachen in der EU wurde übrigens durch die erste Verordnung festgelegt, die die damalige Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) überhaupt erlassen hatte! Rechtsgrundlage für die Verordnung ist aktuell Art. 342 AEUV (auch: AEU-Vertrag, der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union):
Die Regelung der Sprachenfrage für die Organe der Union wird unbeschadet der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union vom Rat einstimmig durch Verordnungen getroffen.
Nach Art. 24 AEUV haben alle Bürger der EU das Recht, sich in einer der 24 genannten Sprachen an die Organe der EU zu wenden und eine Antwort in derselben Sprache zu erhalten.
Nur eine Amtssprache in der EU?

In den EU-Mitgliedsstaaten dominieren nach der Häufigkeit der muttersprachlichen Verwendung Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch und Spanisch. Somit hätte Deutsch gute Chancen, alleinige Amtssprache zu werden, wenn nicht bei Französisch, Englisch und Spanisch auch die weltweite Verbreitung zu berücksichtigen wäre. Außerdem ist und bleibt Englisch die am meisten gesprochene Zweit- und Fremdsprache.
Auch in der EU: der Rechtsruck der Sprache
Wie im deutschen Bundestag, so ist auch in den Debatten des Europäischen Parlaments zu beobachten, dass mit der Anwesenheit rechtspopulistischer bis rechtsextremer nationaler Parteien ein Rechtsruck in der Sprache einhergeht. Völkisches Gedankengut und Rassismus ziehen immer mehr in das Parlament ein, ein Gedankengut, das nichts mit der europäischen Idee zu tun hat. So musste etwa Martin Schulz in seiner Eigenschaft als Präsident des Europäischen Parlaments (von 2012 bis 2017) einen griechischen Abgeordneten des Saales verweisen, wie in diesem Video dokumentiert! Eine Tendenz, die sich nach den Europawahlen noch verschärfen könnte!
(Datenschutz-Hinweis: Mit dem Anklicken des externen Verweises auf YouTube erklären Sie sich mit der Datenweitergabe an Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, einverstanden! Die dort geltenden Datenschutzbestimmungen sind unter https://policies.google.com/privacy abrufbar.)

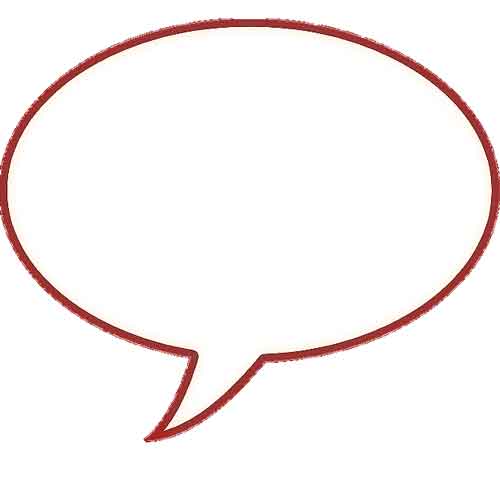
4 Kommentare